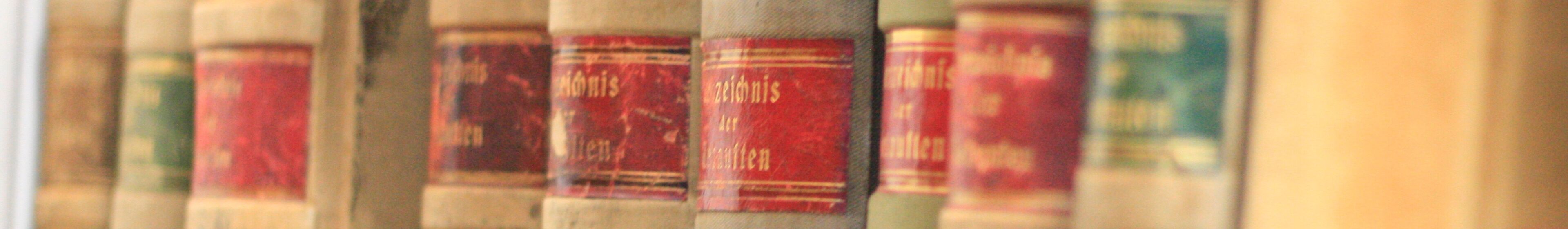Ein »Amt« für Kirchenbücher? · Zum 75. Jubiläum des Kirchenbuchamts Hannover
Vortrag von PD Dr. Hans Otte, Leitender Archivdirektor - Landeskirchliches Archiv Hannover · 08. September 2010
Ein Kirchenbuchamt, ein spezielles Amt für Kirchenbücher und Kirchenbuchführung, ist nicht selbstverständlich – das deutet das Fragezeichen im Titel des Vortrags an. Tatsächlich wurde schon in der Gründungsphase des Kirchenbuchamts gefragt, ob diese Einrichtung nötig sei. Aber diese Feier des 75. Jubiläums zeigt: Es gibt gute Gründe für ein solches Amt, sonst wäre es im Lauf der Jahre wohl schon aufgelöst worden. Tatsächlich war der Weg zum Kirchenbuchamt lang. Nach dem ersten Vorschlag dauerte es noch mehr als 7 Jahre, bis das Kirchenbuchamt 1935 eröffnet wurde.
1928 forderte Ludwig Berkenbusch, Superintendent an der Marktkirche, zum ersten Mal im Stadtkirchenvorstand die Gründung eines »Kirchenbuchamts«. Zur Begründung hatte Berkenbusch darauf hingewiesen, dass genealogische Anfragen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hatten. Schon damals gab es einen Boom an Familienforschung. Möglicherweise hing das mit der Erschütterung der deutschen Gesellschaft nach dem verlorenen Weltkrieg und der Inflation zusammen; man wollte sich seiner Herkunft versichern. Für die Pfarrämter hatte das zur Folge, dass – Zitat Berkenbusch – die Familienforschung »allmählich zu einer nicht mehr tragbaren Belastung auswächst. Dabei hat diese ganze Liebhaberei, deren Wert ich nicht verkenne, mit den Interessen und Aufgaben der Kirche nichts zu tun.«
Trotz dieser vorsichtig-zurückhaltenden Bewertung der Familienforschung warb Berkenbusch für die
Einrichtung eines Kirchenbuchamts. Er wollte die Pfarrämter entlasten, weil die Kirche ja verpflichtet ist, aus den älteren Kirchenbüchern Auskunft zu geben, vor allem aus der Zeit, als es noch keine Standesamtsregister gab. Als er seinen Vorschlag im Stadtkirchenvorstand machte, war das Auskunftsverfahren in der Stadt Hannover höchst kompliziert. Schlimm wurde es vor allem, wenn die Anfragenden nicht wussten, in welcher Kirche ihre Vorfahren jeweils getauft oder getraut worden waren, und das ist gerade für die ältere Zeit meistens der Fall. Die Familienforscher schrieben entweder auf gut Glück ein Pfarramt an – meistens das der Marktkirche –, oder sie schrieben allgemein »an die evangelische Kirche in Hannover«. Wurde die gesuchte Amtshandlung im Kirchenbuch der zuerst angeschriebenen Gemeinde nicht gefunden, wurde die Anfrage an den Gesamtverband der lutherischen Kirchengemeinden Hannovers weitergeleitet.
An die Kanzlei des Gesamtverbandes – heute ist das der Stadtkirchenverband – gingen auch
die Schreiben, die allgemein an die evangelische Kirche Hannovers gerichtet waren. Dort besaß man aber keine Gesamtkartei der Taufen oder Trauungen. Also mussten die Anfragen in einem Umlaufverfahren – als Kettenbrief – nacheinander an alle Pfarrämter in der Stadt geschickt werden, bis eine zutreffende Angaben in einem Pfarrbüro ermittelt wurde. Dies Verfahren war langwierig, aufwendig und teuer, denn für jede Anfrage mussten nacheinander viele Kirchenbücher konsultiert werden, bis irgendwann der Treffer erzielt wurde. Und die Gebühr bekam nur eine Kirchengemeinde – diejenige, die die Taufe oder Trauung zuletzt in ihrem Kirchenbuch nachwies.
In einer solchen Situation versprach ein Kirchenbuchamt natürlich Erleichterung. Schon wenn man nur alle Kirchenbücher an einem Ort nebeneinander aufstellt, lassen sich die Bücher ja rascher auswerten. Aber die gute Idee ließ sich nicht so schnell verwirklichen. Schließlich muss ein solches Amt finanziert werden. »Wer zahlt?« war wie immer die spannende Frage. Der Gesamtverband der Kirchengemeinden hatte dafür kein Geld. Er finanzierte sich durch Umlagen der Kirchengemeinden. Jede neue Aufgabe des Gesamtverbandes bedeutete eine Erhöhung des Beitrags, den die einzelne Gemeinde zahlen musste. Wurde also ein Kirchenbuchamt eingerichtet, stand zu befürchten, dass die Umlage erhöht wurde. Davor schreckte der Stadtkirchenvorstand zurück – die Weltwirtschaftskrise hatte begonnen, es hieß schon, dass die Kirchensteuern rapide zurückgingen. Es wurde noch länger, fast zwei Jahre, hin und her diskutiert, aber in einer solchen Krisensituation wollte keiner ein solches Unternehmen neu beginnen. Damit war jedoch die Frage nicht gelöst, wie man mit den genealogischen Anfragen fertig werden könne. 1931 schlug der neue Stadtsuperintendent, Karl Stalmann aus Limmer, vor, eine Vereinbarung mit dem Staatsarchiv zu treffen. Er hatte darüber schon mit dessen Direktor verhandelt. Das Staatsarchiv war bereit, alle genealogischen Anfragen anzunehmen. Es prüfte zuerst, ob die jeweilige Anfrage aus den Quellen des Staatsarchivs oder des Stadtarchivs zu beantworten war; war das der Fall, brauchte die Anfrage nicht weiter an den Gesamtverband geschickt werden. Sollte das Staats- bzw. das Stadtarchiv hier nicht helfen können, war die Anfrage einem »zuverlässigen Familienforscher« zu übergeben, der sie beantwortete und dafür auch die Gebühr erhielt. Aber diesem Vorschlag widersprach das Geistliche Stadtministerium, der Zusammenschluss der Pfarrer der vier ‚alten‘ Kirchen, sehr deutlich. Für die Pastoren der Altstadtkirchen, die damals ja noch intakt waren, war die Sache klar: Die Gebühren aus den genealogischen Anfragen sollten weiterhin die Kirchengemeinden erhalten, wenn kein Kirchenbuchamt gegründet wurde. Schließlich waren die Gebühren ja ein Teil des Einkommens des Diakons oder des Küsters, der die Auskünfte erteilte. In Zeiten der Wirtschaftskrise waren auch kleinere Summen wichtig, auf sie wollte das Geistliche Stadtministerium nicht ohne weiteres verzichten. Der Einspruch der Altstadtpastoren lässt einen Interessenkonflikt erkennen: Die ‚alten’ Kirchengemeinden wünschten sich ein Kirchenbuchamt, weil sie viele Kirchenbücher besaßen und viele Anfragen zu beantworten hatten. Weil die jüngeren Kirchengemeinden – als ‚jung‘ galten die Kirchen, die nach 1875 gegründet worden waren – keine Kirchenbücher aus der Zeit vor Einrichtung der Standesämter (1874) hatten, erhielten sie nur selten Anfragen, brauchten also kaum zu suchen und konnten Anfragen gleich weiterleiten. Ihnen erschien das bisherige Verfahren als ausreichend, für ein Kirchenbuchamt wollten sie kein Geld ausgeben. Das war bei den älteren Kirchengemeinden naturgemäß anders; sie wollten ihre Pfarrbüros von dieser zeitraubenden Arbeit entlasten und plädierten deshalb für diese neue Einrichtung, schließlich brachte ein Kirchenbuchamt Einnahmen und damit konnte man in dieser Zeiten der großen Arbeitslosigkeit mindestens einen kirchlichen Mitarbeiter weiterbezahlen, dem sonst die Entlassung drohte. Diese Überlegung war für das Geistliche Stadtministerium ein schlagendes Argument, es beharrte deshalb auf dem Vorschlag, ein Kirchenbuchamt einzurichten. Ebenso blieben die Gemeinden der früheren Vorstädte bei ihrer Ablehnung, denn sie profitierten von einem solchen Amt kaum. So blockierten sich die Gemeinden im Stadtkirchenverband gegenseitig, es blieb beim bisherigen aufwendigen Verfahren ohne Kirchenbuchamt.
***
Zwei Jahre später hatte sich die Situation verändert. Am 1. August 1933 hatte der seit dem 31. Januar 1933 amtierende nationalsozialistische Innenminister Wilhelm Frick »im bevölkerungs- und rassepolitischen Interesse« einen neuartigen »Schriftdenkmalschutz« eingeführt. Denkmalschutz sollte nicht nur Bauten und Museen gelten, sondern sollte die schriftlichen Quellen einschließen, »die Zeugnis vom Werden und Schicksal des deutschen Volkes geben«. Damit waren primär die Kirchenbücher gemeint, und der neu in das Reichsinnenministerium berufene »Sachverständige für Rasseforschung«, Dr. Achim Gercke, hoffte dabei wohl auf die Kooperation mit den Kirchen, die die Eigentümer der meisten Kirchenbücher waren.
Es war kein schlichtes historisches Interesse, das zu diesem Denkmalschutz geführt hatte. Der Schriftdenkmalschutz war ein Schritt zur ‚Nazifizierung’ der deutschen Gesellschaft. Vorangegangen waren das Ermächtigungsgesetz, also die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und der konsequente Rechtsschutz am 24. März 1933, der sog. Judenboykott am 1. April und das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7. April 1933. Seitdem mussten die Deutschen, die öffentliche Funktionen bekleideten, ihre arische Herkunft belegen, die Zeit der »Ariernachweise« hatte begonnen. Dass das Schritte zur Deportation und Vernichtung von Millionen von »Nichtariern« waren, war damals wohl noch nicht abzusehen, wohl aber, dass Deutsche jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft aus dem öffentlichen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden sollten. Aber die Kirchenleute dachten nicht so weit. Ihre Überlegung war schlicht: ‚Wir helfen doch bloß unseren Kirchenmitgliedern. Sie haben in der Regel »arische« Vorfahren, warum sollte man ihnen die Bescheinigungen nicht ausstellen?’ In dieser Perspektive sahen sie diese Recherchen und das Ausstellen des Ariernachweises – als Hilfe für die eigenen Leute. Ignoriert wurde, dass eine große Gruppe von Mitbürgern damit gefährdet und ausgeschlossen wurde.
Der nationalsozialistische Diskurs über Volksgemeinschaft, Rasse, Blut und Boden, der diese Schritte zum nationalsozialistischen Deutschland begleitete, eröffnete eine neue Runde in der Diskussion über ein Kirchenbuchamt. Dabei schaltete sich ein neuer Diskussionsteilnehmer ein, Dr. Walther Lampe. Seit einigen Jahren schon war der Jurist Lampe, Jahrgang 1894, im Landeskirchenamt für die Archiv- und Kirchenbuchfragen zuständig. Auf der Suche nach Sponsoren für ein landeskirchliches Archiv war er schon früher auf die Familienforscher gestoßen und hatte zusammen mit Freunden, zu denen der Celler Oberbürgermeister Meyer gehörte, im Herbst 1932 die Idee entwickelt, ein zentrales Kirchenarchiv aufzubauen. In diesem Zentralarchiv sollten nicht nur kirchliche Akten, sondern auch die gefährdeten Kirchenbücher aus dem Bereich der Landeskirche untergebracht werden. Die Stadt Celle wollte dafür die Räume bereitstellen. Im »freiwilligen Arbeitsdienst« sollten »stellungslose Akademiker« die Kirchenbücher abschreiben und verzetteln, das Landesarbeitsamt wollte dies Personal finanzieren. Das Projekt war gut durchgerechnet, nur längerfristig war die Finanzierung offen. So schien es einen Moment, im November 1932, möglich zu sein, ein großes landeskirchliches Archiv zu gründen, das auch die älteren hannoverschen Kirchenbücher betreute. Damit hätte auch die Diskussion über ein Kirchenbuchamt in Hannover ein gutes Ende gefunden. Aber die Landessynode, der dieses Projekt in der Novembertagung 1932 vorgelegt worden war, hatte die Entscheidung verschoben. In einer Resolution hatte sie die Einrichtung eines »Landeskirchenarchivs« zwar begrüßt, hatte aber gleichzeitig empfohlen, angesichts der schwierigen Haushaltslage der Landeskirche mit der Gründung zu warten.
***
Ein halbes Jahr später, im Sommer 1933, hatte sich die Situation verändert. Die Kirchenbuchbenutzung war rasant angestiegen. Hatte Berkenbusch schon 1928 über die Belastung geklagt, so war sie im Vergleich dazu geradezu unermesslich geworden. Lampe hoffte wohl, dass das Interesse an den ‚Ariernachweisen’ als vorzügliches Argument für sein Kirchenarchiv mit dem angeschlossenem Kirchenbuchamt dienen könne. Aber das erwies sich rasch als Illusion. Gerade zu dem Zeitpunkt, als der Reichsinnenminister den Erlass über den Schriftdenkmalschutz veröffentlichte, lehnte die Reichsleitung des Arbeitsdienstes den Antrag auf Verzeichnung der Kirchenbücher ab. In dem Ablehnungsbescheid hieß es: »Da es sich im Arbeitsdienst (des 3. Reiches) um das Heranbringen der Jugend an den Boden und damit um Arbeiten mit Picke und Spaten handelt, ist es leider nicht möglich, den Arbeitsdienst, so wie … vorgeschlagen, einzusetzen.«
Lampe gab aber nicht auf. Zur gleichen Zeit änderte sich seine Position in der Landeskirche und im Stadtkirchenverband. War er bis dahin ein tatkräftiger junger Mann ohne Führungsverantwortung gewesen, so wurde er nun Oberlandeskirchenrat und Dezernatsleiter. Die Deutschen Christen hatten in der Landeskirche die Macht ergriffen, und Lampe profitierte davon. Er galt als ihr Mann. Am 23. Juli 1933 war er in den Kirchenvorstand der Lutherkirche gewählt worden und wurde wenig später Mitglied in der Vertreterversammlung des Gesamtverbandes, dem heutigen Stadtkirchentag. Gleichzeitig wurden im Landeskirchenamt alle leitenden Beamten in den Ruhestand versetzt, die als Gegner der Deutschen Christen und damit der Nationalsozialisten galten. Lampe wurde dagegen zum Oberlandeskirchenrat ernannt und gehörte als Dezernatsleiter zum Kreis der führenden Beamten. Er hatte damit eine Doppelposition: Lokal, auf der Ebene der Stadtkirche, war er als Laie führend tätig und konnte später, als er auch noch Vorsitzender der Vertreterversammlung wurde, Entscheidungen durchsetzen. Auf landeskirchlicher Ebene war er als Oberlandeskirchenrat an der Aufsicht über den Stadtkirchenverband beteiligt und konnte Beschlüsse des Stadtkirchentags befördern oder anhalten. Und dies nutzte er nun für das kirchliche Archivwesen.
Im September 1933 wurde dem Vertretertag des Gesamtverbandes – also dem heutigen Stadtkirchentag – ein Gutachten für ein Kirchenbuchamt vorgelegt. Darin wurden vier gute Gründe für ein Kirchenbuchamt genannt. Am wichtigsten war die Entlastung der Geistlichen und Küster. Sie mussten nicht mehr in den Büchern selber suchen; das konnten geschulte Kräfte im Kirchenbuchamt effektiver machen. Das zweite Argument betonte den Aspekt der Sicherung. In einem Kirchenbuchamt mit festen Schränken waren die Bücher besser gesichert und geschützt; die Aufbewahrung war nicht mehr so zufällig wie bisher. Wichtig war – drittens – die Kostenersparnis durch Benutzen einer Schreibmaschine. Bis dahin wurden die Kirchenbücher zweimal mit Hand geschrieben, einmal als Original und als Zweitschrift zur Sicherheit. Die Schreibmaschine erlaubte ein Durchschreibeverfahren mit mehreren Durchschlägen (Kohlepapier); die Führung des Kirchenbuchs erforderte nur halb soviel Zeit. Als vierten Punkt wurde noch der Vorteil einer »zentralen Bearbeitung der sich gerade jetzt sehr häufenden Anfragen wegen Beschaffung von Nachweisen über die Abstammung« genannt. Nur so – indirekt – wurde auf die NS-Rassepolitik Bezug genommen. Vorrangig ging es also um pragmatische Überlegungen zur Beschleunigung der wenig geliebten Büroarbeit. Im Stadtkirchenvorstand war die Relevanz des Themas zunächst wohl nicht recht erkannt worden, der Vorschlag wurde auf der Sitzung des Stadtkirchenvorstands unter »Verschiedenes« behandelt. Aber schon hier zeichnete sich eine Veränderung des Diskussionsklimas ab: Der geschäftsführende Vorstand lehnte den Vorschlag nicht mehr ab, sondern begrüßte ihn, sofern der Gesamtverband der hannoverschen Kirchengemeinden die Finanzierung absicherte. Der Vertreterversammlung des Gesamtverbandes, also dem Stadtkirchentag, gehörte inzwischen Lampe an, hier konnte er die Meinungsbildung steuern. Auf seiner Sitzung am 23. November 1933 beschloss der Stadtkirchenverband, ein Kirchenbuchamt einzurichten. Dazu gewährte die Landeskirche einen Kredit zur Anschubfinanzierung, diesen hatte vermutlich Lampe eingeworben.
Blickt man auf die innerkirchliche Debatte, könnte man meinen, es wäre nur um eine überfällige Rationalisierung der Verwaltung gegangen, etwa um die Einführung der Schreibmaschine. Sie bot innerkirchlich ein schlagendes Argument. Denn die neue Konzeption des Kirchenbuchamts half auch den jüngeren Kirchengemeinden. Es ging nicht mehr bloß um Auskünfte aus den alten Kirchenbüchern wie im Vorschlag von 1928, sondern um die aktuelle Kirchenbuchführung: Die Pfarrbüros aller Kirchengemeinden wurden entlastet, wenn die aktuelle Kirchenbuchführung vom Kirchenbuchamt übernommen wurde. Vor allem dieser Aspekt wies in die Zukunft.
Es gab aber nicht nur den Blick nach innen mit dem Ziel Rationalisierung. Es gab ja auch den Blick nach außen, zum gesellschaftlichen Umfeld, das inzwischen nationalsozialistisch dominiert wurde. Hier war ganz anderes zu hören, denn zur Information der Öffentlichkeit wurden die nationalsozialistischen Sprachregelungen benutzt. Die erste Meldung über das geplante Kirchenbuchamt erschien am 24. November 1934 in der nationalsozialistischen »Niedersächsischen Tageszeitung« (NTZ): »Ein Stadtkirchenbuchamt in Hannover. Arbeit im Dienste des Volksganzen«. Kommentiert wurde der Beschluss so: »Besonders freudig werden diesen Beschluß die zünftigen Familienforscher begrüßen. Es ist ja noch nicht lange her, als sie über die Schulter angesehen wurden. Familienforscher galten im allgemeinen als unbequeme Leute, Familienforschung galt als eine Marotte. Im Staate Adolf Hitlers ist das anders geworden. Endlich ist die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Familienforschung für das Volksganze zum Durchbruch gekommen.« Worin nun die Bedeutung der Familienforschung bestand, wurde nicht genauer ausgeführt; dazu hieß es nur: »Es ist hier nicht der Platz, von der Bedeutung der Kirchenbücher im einzelnen zu sprechen. Ihre gesicherte Erhaltung steht heute im Vordergrund des Interesses. Ihre volle Auswertung ist die Aufgabe der Zukunft. Diese Aufgabe hat … das Stadtkirchenbuchamt zu erfüllen, das zugleich für die Gegenwart und Zukunft die fortlaufende Kirchenbuchführung sämtlicher Gemeinden der Stadt übernimmt.« Immerhin räumte der Verfasser des Artikels ein, dass der Beschluss nicht selbstverständlich war: »Es ist keine Frage, daß es den Geistlichen, der an seinen Kirchenbüchern hängt, schmerzlich berühren wird, wenn er sie nicht weiter betreuen darf. Aber auch hier muß der Grundsatz gelten: Gemeinnutz geht vor Eigennutz.«
So wurde das Kirchenbuchamt dem nationalsozialistischen Leser angedient; die Niedersächsische Tageszeitung war die Zeitschrift der NSDAP für den hiesigen Gaubezirk. Mit dem Beschluss zur Gründung eines Kirchenbuchamts hatte sich die evangelische Kirche der Stadt Hannover dem nationalsozialistischen Diskurs angepasst, ein Stück Gleichschaltung wurde hier verwirklicht. Immerhin machte der Hinweis auf die Geistlichen deutlich, dass es Widerstand gegeben hatte. Selbst wenn man intern anders dachte und handelte, nach außen hin gliederte man sich ein und verstärkte so noch den Eindruck der allgegenwärtigen gleichgeschalteten Volksgemeinschaft.
***
Damit aber das Kirchenbuchamt seine Arbeit aufnehmen konnte, waren ‚Vorarbeiten’ nötig: Der Gesamtverband kaufte in der hannoverschen Ubbenstraße das Nachbarhaus zur bisherigen Kanzlei; die Wand wurde durchbrochen und es wurden Panzerschränke für die Kirchenbücher angeschafft. Gleichzeitig wurden die Kirchengemeinden verpflichtet, für ihre Kirchenbücher ganz neue Register in Karteiform anzulegen. Dafür hatten die Kirchengemeinden ein Jahr Zeit. Erst dann waren die Kirchenbücher dem Kirchenbuchamt zu übergeben. Für die Register zu den Kirchenbüchern entwickelte der Verwaltungsdirektor des Gesamtverbandes, Diakon Ernst Strohmeyer, ein ganz neues System. Wer im Kirchenbuchamt schon einmal geforscht hat, wird diese Karten in den Stehordnern, den »Kapseln« kennen. Für die Eintragung der einzelnen Amtshandlungen wurden Karten im Format 22,5 x 8,5 cm auf hochwertigem Papier gedruckt; sie wurden in kleinen Stehordnern zusammengefasst und konnten dort ohne weiteres entnommen, umsortiert oder ergänzt werden. Den Kirchengemeinden wurde empfohlen für das Ausfüllen der Karten »geeignete und bewährte Personen mit guter Handschrift als Aushilfskräfte mit täglicher Kündigung … einzustellen«. Für die Entlohnung jeder Hilfskraft zahlte der Gesamtverband den Kirchengemeinden wöchentlich 30,- RM; Arbeitslose konnten sich diese Arbeit zugleich als »Pflichtarbeit« anrechnen lassen, zu der sie das Wohlfahrtsamt verpflichten konnte, wenn sie eine Unterstützung beantragten. Bis zum Ende des Jahres 1934 sollten alle Amtshandlungen der Jahre 1774–1874 auf den Karten eingetragen sein, die Zeitgrenze 1774 war vermutlich wegen der »Ariernachweise« festgelegt worden: Bis dahin waren 160 Jahre, also mindestens vier Generationen vergangen, so dass alle Fragen nach den »arischen« Großeltern beantwortet werden konnten. Einige Kirchengemeinden konnten die Arbeit an diesen Registern erst im Frühjahr 1935 abschließen, so dass das Kirchenbuchamt am 1. April 1935 offiziell seine Pforten öffnen.
Stolz konnte dabei eine erste Leistungsbilanz gezogen werden: 510 Kirchenbücher aus 30 Kirchengemeinden aus der Zeit ab 1574 standen für die Arbeit bereit. Die älteren Bücher waren in Panzerschränken untergebracht. Das Generalregister für die Jahre 1774-1874 mit 600.000 Karten war fertiggestellt und bot Raum für insgesamt 4 Millionen Karten. Insgesamt acht Mitarbeiter arbeiteten in der neuen Dienststelle, die in drei Abteilungen gegliedert war: das Kirchenbucharchiv mit den älteren Kirchenbüchern; das Kirchenbuchamt, das für die laufende Kirchenbuchführung zuständig war, und die Sippenkanzlei, die alle genealogischen Anfragen erledigen sollte. Das neu konzipierte Durchschreibeverfahren erledigte vier Arbeitsgänge in einem: die eigentliche Kirchenbucheintragung, die Ausfertigung der Urkunde für den jeweils Betroffenen sowie die Durchschriften für das Nebenbuch und für das Generalregister. Allerdings wurden aktuell nur zwei Kirchenbücher im Kirchenbuchamt geführt, nämlich die Taufbücher und die Traubücher. Die Bücher für Konfirmationen und für Beerdigungen sowie die Kommunikantenregister wurden »um ihrer mehr seelsorgerischen Bedeutung willen« weiterhin in den Einzelgemeinden geführt. Hier hatten sich die Pastoren durchgesetzt, die den Wert der Kirchenbücher für die Gemeindearbeit betonten, schließlich gab es noch keine verbindlichen Gemeindegliederkarteien. In den beiden ersten Monaten wurden mehr als 2.000 genealogische Anfragen bearbeitet; später sank die Zahl leicht. Aber erst lange nach dem Krieg war es möglich, nach und nach auch für die älteren Kirchenbücher, also für die Zeit von 1574 bis 1774, Register anzulegen, erst in den achtziger Jahre unter der Ägide von Herrn Reese, des Vorgängers von Frau Klein als Leiter des Kirchenbuchamts, konnte diese Arbeit an den Registern abgeschlossen werden.
***
Insgesamt konnte bei der Eröffnung des Kirchenbuchamts eine eindrucksvolle Bilanz präsentiert werden. Binnen eines Jahres hatte man die Bücher zusammengeführt und Register angelegt. Über die Eröffnung des Kirchenbuchamts und dessen Leistungsbilanz berichteten die hannoverschen Zeitungen. Bei diesen Berichten fällt aber auf, dass bei dem kleinen Festakt zur Eröffnung zwei Gruppen fehlten: die Repräsentanten der Stadtverwaltung und der NSDAP. Die Feier war eindeutig kirchlich dominiert: Der Stadtsuperintendent und der Laienvorsitzende des Gesamtverbandes, der Generaldirektor der Kapitalversicherungsanstalt (Landesbank) Georg Schimmler, begrüßten die Teilnehmer. Aus dem ‚politischen Raum‘ fehlten hochrangige Vertreter. Allein Walther Lampe, der inzwischen Mitglied der NSDAP geworden war, repräsentierte die Verbindung zum NS-Staat. Er konnte den Anwesenden berichten, dass schon wenige Tage zuvor der zuständige Sachbearbeiter des Reichssippenamts die Genehmigung erteilt habe, das Kirchenbuchamt als »Sippenkanzlei« zu bezeichnen. Er selbst, Lampe, sei »ermächtigt, die Sippenkanzlei für eröffnet zu erklären«.
Die Abstinenz von Partei und Kommune ist bemerkenswert, half doch das Kirchenbuchamt vielen Menschen, einen zentralen Anspruch der Nationalsozialisten zu erfüllen, Ariernachweise vorzulegen. Warum fehlten nun die Vertreter der Stadt und der Partei? Der Grund waren vermutlich heftige Auseinandersetzungen über das neue Kirchenbuchamt, hinter den Kulissen. Stein des Anstoßes war die Bezeichnung »Sippenkanzlei«. Denn auf dem Gebiet der Familienforschung gab es in Hannover noch andere Interessenten: die historischen und genealogischen Vereine und die Archive in der Stadt. Verärgert war vor allem der Stadtarchivar, der bei den Verhandlungen über das Kirchenbuchamt nicht beteiligt worden war. Archivdirektor Karl Friedrich Leonhardt wollte den durch die Rassenideologie und speziell die Ariernachweise ausgelösten Boom gern für sein Stadtarchiv nutzen. Schon im April 1934 hatte er von Lampes Gutachten über das Kirchenbuchamt gehört. Sofort schrieb er an den Oberbürgermeister, damit sich dieser in die Verhandlungen einschalte: »Mit Rücksicht auf die wichtigen und dringenden Aufgaben, die ein modernes Stadtarchiv im heutigen Staat zu erfüllen hat«, solle der Oberbürgermeister beim Landeskirchenamt dafür eintreten, »daß die Zentralisierung nicht beim Gesamtverbande, sondern bei dem Stadtarchiv, als der … einzig dafür in Frage kommenden Stelle erfolgt«. »Geistliche oder Kirchenbeamte sind letzten Endes auf keinen Fall die geeigneten Persönlichkeiten, um Kirchenbücher fachgemäß nach jeder Richtung hin auszuschöpfen, da ihnen zu dieser nicht immer einfachen und entsagungsvollen Arbeit Fachbildung und Praxis meist fehlt.« Wenigstens die Kirchenbücher der alten vier städtischen Patronatskirchen reklamierte der Stadtarchivar für sich. An jüngeren Büchern war er nicht interessiert, die Masse der Anfragen sollte weiterhin vom Kirchenbuchamt im Gesamtverband erledigt werden. Um in dieser Konkurrenzsituation gleich Fakten zu schaffen, gründete Leonhardt am 7. Juli 1934 im Stadtarchiv eine »Städtische Beratungsstelle für Sippenforschung, Wappenkunde und verwandte Gebiete«. Ein junger Genealoge, zugleich ein flammender Nationalsozialist, wurde dafür eigens als neuer Mitarbeiter eingestellt. In einer Werbebroschüre erklärte das Stadtarchiv stolz, dass diese Sippenforschungsstelle »als erste (derartige) städtische Sonderabteilung in Deutschland im Jahre 1934 eingerichtet wurde«. Angesichts der Bedrohung, die das Kirchenbuchamt in Leonhardts Augen für das Stadtarchiv bedeutete, war es wohl ganz verständlich, dass an der Eröffnung des Kirchenbuchamts kein Vertreter der Stadt teilnahm. Aber auch nach der Eröffnung des Kirchenbuchamts war Archivdirektor Leonhardt nicht bereit, kampflos das Feld zu räumen. Die Bezeichnung »Sippenkanzlei« beanspruchte er für sein Archiv. An das Landeskirchenamt schrieb er: Werde das Kirchenbuchamt als Sippenamt oder Sippenkanzlei bezeichnet, sei das »eine unbewußte Irreführung des Publikums, welches … annimmt, daß es sich um eine städtische Dienststelle handelt«. Als aber das Landeskirchenamt diese Beschwerde erst ignorierte und dann auf die lange Bank schob – es wies darauf hin, dass der Begriff ‚Sippenkanzlei’ noch nicht gesetzlich geschützt sei –, handelte die Stadt auf eigene Faust. Am 8. Mai 1935, sechs Wochen nach Eröffnung des Kirchenbuchamts, eröffnete Leonhardt mit Genehmigung des Oberbürgermeisters die »Sippenkanzlei der Stadt Hannover« im Stadtarchiv. Parallel zum Kirchenbuchamt erteilte diese Sippenkanzlei Auskünfte und stellte die Ariernachweise aus, soweit sie Quellen dafür besaß.
Uns Heutigen ist diese Auseinandersetzung um den Begriff Sippenkanzlei kaum verständlich, schließlich gehört »Sippe« heute zu den nationalsozialistisch belasteten Worten. Die Nationalsozialisten benutzten den Begriff Sippenforschung für ihre rassistisch motivierte Genealogie: Die Sippe reichte über die Kleinfamilie hinaus, durch die Blutsbande und die Verschwägerung legt sie das Schicksal des Sippenangehörigen fest. Hier die entsprechenden Festlegungen zu treffen, war Aufgabe des Reichssippenamts. In den ersten Jahren war es primär eine Forschungsstelle, später wurde es von der SS übernommen und beteiligt sich auf seine Weise aktiv an den Massenmorden. Das Reichssippenamt plante, die Standesämter langfristig durch Sippenämter zu ersetzen. Die Sippenämter sollten nicht nur die rechtlichen Voraussetzungen für die Eintragungen in die Standesamtsregister prüfen, sondern auch im Sinne der sog. Erbgesundheit tätig werden, also Eheschließungen und möglichst alle Geschlechtsbeziehungen überwachen und notfalls verbieten. Für die »Forschungen« zu diesem Thema, vor allem zu den Erbkrankheiten, waren die älteren Kirchenbücher unverzichtbar, daher gab es ja bei ihnen dieses starke Interesse an den Kirchenbüchern. In der Perspektive der Nationalsozialisten war die Sippenforschung also Zukunftsforschung. Wer hier über die einschlägigen Quellen verfügte, konnte mit entsprechender Förderung rechnen. Beide, Stadtarchivar Leonhardt wie Walther Lampe, ließen sich auf diese Perspektive ein.
***
Der Kirchenhistoriker Klaus Scholder hat das Jahr 1933 für die führenden Kirchenleute als das »Jahr der Illusionen« beschrieben. Auch Lampe hatte sich hier Illusionen über den kirchenfreundlichen Charakter der Nationalsozialismus und über deren Interesse an der Familienforschung gemacht. Er hätte allerdings schon misstrauisch werden können, als keine hannoverschen NS-Größen zur Eröffnung des Kirchenbuchamts gekommen waren. Doch in den beiden ersten Jahren der NS-Herrschaft, 1933/34, sah Lampe diese Gefahr nicht. Erst als 1935/36 der kirchenfeindliche Kurs der NSDAP deutlich wurde, wurde Lampe zurückhaltend. Und in der Frage der Kirchenbücher war Lampe zu keiner Konzession bereit. 1936 beteiligte er sich schon an der Organisation des Zusammenschlusses der Kirchenarchivare in Deutschland, damit sie sich besser gegen die Übergriffe staatlicher und kommunaler Stellen wehren konnten. Erkennbar wird dieser Positionswandel zum ersten Mal im März 1936. Damals sprach er auf der zentralen Jahrestagung des Bundes der deutschen Standesbeamten – wenn man so will: in der Höhle des Löwens, denn auch die Standesbeamten hofften auf die Kirchenbücher. Lampe argumentierte in diesem Kreis offensiv. Die Behauptung, erst der NS-Staat habe den Wert der Kirchenbücher entdeckt, wies er energisch zurück. Den folgenden Satz muss man gelegentlich auch heute noch gegen manche Genealogen wiederholen. Lampe sagte: ‚Die Kirche hat ihre Bücher immer gehütet; es trifft nicht zu, wie manche Leute heute gern behaupteten, »daß … die meisten Kirchenbücher aus alter Zeit durch Pfarrhausbrände oder gar durch Nachlässigkeit der Pfarrer verlorengegangen sind, sondern … die vielen Kriege haben hier am schlimmsten gehaust.« Lampe fuhr mit dem Hinweis fort, dass die Kirche nach Einführung der Standesamtsregister ihre Bücher weitergeführt habe, dies sei doch ein Zeichen, wie sehr die Kirche ihre Kirchenbücher achte. Denn sie beurkunden »die wichtigsten kirchlichen Ereignisse im Leben eines jeden … Denn noch heute bedeuten die Tage der Taufe, der kirchlichen Trauung, der Konfirmation usw. großen Teilen der deutschen Bevölkerung etwas, was sich über den Alltag hinaushebt … Bei einem Hochzeitstage, der sich zum 25. oder gar 50. Male jährt, wird man sich nicht so sehr an die standesamtliche Eheschließung erinnern als gerade an die kirchliche Trauung in der heimatlichen Kirche.« Genau das dokumentieren aber die Kirchenbücher. Lampe wies außerdem noch auf die Popularität der Goldenen Konfirmation hin, die wenige Jahre zuvor erst neu eingeführt worden war. Sie zeige, wie wichtig den Kirchengliedern die genauen Erinnerungen an die kirchlichen Amtshandlungen seien. – Von Sippenforschung war hier nicht mehr die Rede, hier ging es um das zentrale Handeln der Kirche. Die Kirchenbücher bieten »selbstverständlich in erster Linie zur Geschichte des kirchlichen Lebens und der Kirche den maßgeblichen Beitrag«; deshalb – so Lampes Folgerung – mussten sie im kirchlichen Besitz bleiben und hier verwaltet werden.
Lampes Ideal war eine funktionierende Volkskirche. Kern der Volkskirche sind die Amtshandlungen, die von allen Gemeindegliedern wahrgenommen werden, auch von denen, die sonst kaum in den Gottesdiensten zu sehen sind. Zur Volkskirche gehört auch die Einbindung in die Heimat und deren Geschichte. Deshalb lag ihm soviel an den Kirchenbüchern. Ein gutes Verhältnis zum Staat gehörte für ihn aber zur Normalität der traditionellen Volkskirche. Diese Wahrnehmung von Heimat und Volkskirche war wohl der Grund dafür, dass sich Lampe in der Zeit der Illusionen auf die nationalsozialistische Perspektive der »Sippenkanzlei« eingelassen hatte. Auf seine Weise hat er den nationalsozialistischen Diskurs über die Volksgemeinschaft verstärkt und damit zur Ausgrenzung der sog. Nichtarier beigetragen. Soweit ich sehe, ging es ihm nicht ernsthaft um die NS-Ideologie; er nutzte vielmehr ganz pragmatisch die Möglichkeiten des nationalsozialistischen Diskurses, um sein Ziel zu erreichen: Kirchenbücher als Prototypen der kirchlichen Archivalien langfristig zu schützen und ihre Auswertung zu ermöglichen. Nachdem er dieses Ziel erreicht hatte und die Kirchenfeindschaft der Nationalsozialisten erkennbar wurde, korrigierte er seine Position zu den Zumutungen des NS-Staats leise. Anfangs hatte er Wert darauf gelegt, dass das Kirchenbuchamt eine »Sippenkanzlei« sei. Als aber 1940 die Briefbögen mit den Bezeichnungen Kirchenbuchamt und Sippenkanzlei zu Ende gingen, wurde bei den neuen Briefbögen auf die Bezeichnung »Sippenkanzlei« verzichtet.
Angesichts der Bedeutung der ‚Sippenkanzlei’ für die Gründungsphase des Kirchenbuchamts könnte man vermuten, dass der Zusammenbruch der NS-Herrschaft das Ende des Kirchenbuchamt bedeutet hätte. Aber das Kirchenbuchamt war mehr als eine Sippenkanzlei. Als die Forschungsaufträge auf ein Minimum zurückgingen, zeigte sich, wie entscheidend das andere Standbein, die aktuelle Kirchenbuchführung war. Denn die Arbeit für die Kirchengemeinden ging weiter, auch ohne ‚Sippenforschung‘. Neben die Kirchenbuchführung trat das Meldewesen. Nach dem Krieg und den ‚Verschiebungen‘ der Bevölkerung aufgrund von Flucht und Vertreibung war es wichtig, dass die Kirchengemeinden verlässliche Angaben über ihre Gemeindeglieder erhielten. Wenn man so sagen will: Deutschland war mobil geworden – nicht nur durch die Flüchtlinge, sondern auch durch die Ausgebombten, die zurück in ihre alte Wohnung drängten. Dementsprechend rasch veränderten sich die Meldedaten. Dennoch sollten die Angaben zu den Gemeindegliedern stimmen. So mussten die Daten kontinuierlich gepflegt werden. Diese Arbeit leistete das Kirchenbuchamt. Es übernahm die von der Stadt Hannover gemeldeten Daten und übertrug sie in die Mitgliederdatei. Herr Reese hat mir erzählt, dass es jeweils lange Listen – erst Durchschläge und später Papierausdrucke – von der Stadt Hannover gab. Auf ihnen waren die Namen der Neuzugezogenen, der Geburten usw. vermerkt. Sie mussten dann einzeln auf Karteikarten eingetragen werden, die in großen Kartentrögen standen. Zeitweise gab es dafür im Kirchenbuchamt neun Mitarbeiter für den Bereich Meldewesen und zwei Mitarbeiter für die Kirchenbuchauskünfte.
Überblickt man die Zahl der Mitarbeiter im Lauf der Jahre, so ist die gegenwärtige Personalgröße besonders eindrucksvoll. Heute sind im Kirchenbuchamt drei Mitarbeiterinnen tätig. Anfangs waren es acht Mitarbeiter, dann stieg die Zahl auf elf – wie gesagt, vor allem für das Meldewesen –, heute sind es nur noch drei Mitarbeiter: für das Meldewesen, die Kirchenbuchführung und die Auskünfte aus den Kirchenbüchern. Die Verkleinerung der Mitarbeiterzahl verdankt sich vor allem der Einführung der EDV; hier hat sie wirklich für eine schlanke Verwaltung gesorgt. Betreut werden dabei nicht bloß 30 Kirchengemeinden, wie zur Anfangszeit, sondern 62 Kirchengemeinden. Und die drei Mitarbeiter haben auch in der genealogischen Forschung mehr zu tun, weil das Kirchenbuchamt ja zusätzlich die Filme bzw. Mikrofiches der Kirchenbücher aus der gesamten Landeskirche verwaltet.
1989 übernahm das Kirchenbuchamt die Mikrofiches vom Landeskirchlichen Archiv. Das Landeskirchliche Archiv hatte die Verfilmung besorgt, kann aber wegen seines kleinen Benutzerraums gar nicht so viele Lesegeräte anbieten, wie nötig sind, um alle Interessenten zufrieden zu stellen. Das übernahm das Kirchenbuchamt. Erfreulicherweise wurde auch gleich der Raum für die Lesegeräte miteingeplant, als der Umzug des Kirchenbuchamts in dies neue Gebäude vorbereitet wurde. Die Landeskirche ist dem Stadtkirchenverband wirklich dankbar, dass das Kirchenbuchamt und vor allem dessen Mitarbeiterinnen die mit den Microfiches verbundene Aufgabe mit übernommen haben. Genauso dankbar sind wohl die Benutzer, weil ihnen hier an einer Stelle so viele Kirchenbücher aus einem großen Gebiet präsentiert werden. Soweit ich sehe, funktioniert das sehr gut. Ich vermute, viele von Ihnen, meine Damen und Herren, können das bestätigen.
Als Referent im Landeskirchenamt für das Archiv- und Bibliothekswesen der Landeskirche landen auf meinem Schreibtisch die Klagen über Kirchenbuchämter oder über Pfarrämter, die sich nicht um Kirchenbücher oder Familienforscher kümmern. Klagen über das hannoversche Kirchenbuchamt kommen hier nicht vor. Das ist wirklich ein gutes Zeichen, denn Genealogen sind oft durchaus streitbar und klagefreudig. Dass es faktisch keine Klagen über das hannoversche Kirchenbuchamt gibt, ist ein gutes Zeichen für dessen Qualität und die hiesige Freundlichkeit.
Sieht man so auf die gute Arbeit des Kirchenbuchamts, wird noch klarer, warum mein Vortrag ein Fragezeichen in seinem Titel hat. In der Regel verbinden wir mit einem »Amt« ein bürokratisches, im Zweifel sogar unfreundliches Verhalten. Das kann man vom Kirchenbuchamt nicht sagen. Es ist eine sehr kundenorientierte »Dienststelle«. Dienen ist bekanntlich eine hochwertige christliche Tugend. Soweit ich sehe, wird diese Tugend hier tatsächlich praktiziert. Insofern ist das Kirchenbuchamt eben kein richtiges Amt – aber gerade das ist sein großer Vorteil.
So brauche ich dem Kirchenbuchamt zuletzt nur den einen Wunsch für die Zukunft mitgeben: Möge es sich wie bisher als »Dienststelle« verstehen, genauer: Mögen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit wie bisher weiterführen, als Dienst an Benutzerinnen und Benutzern, an Kirchengemeinden und letztlich an der ganzen Kirche.